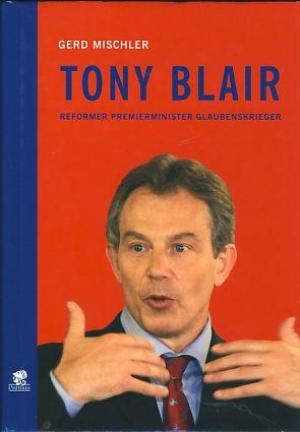
Basierend auf der Biographie von Gerd Mischler
Seit 1996 ist keine deutsche Biografie von Tony Blair mehr erschienen. Der Publizist Gerd Mischler versucht, diese Lücke zu füllen, was ihm auch teilweise mit Tony Blair. Reformer Premierminister Glaubenskrieger (Amazon.de) gelingt. Biografien zu Zeitgenossen haben das Manko, das sie naturgemäss nicht auf Archivmaterial beruhen. Beim vorliegenden Werk kommt erschwerend hinzu, dass der Autor keine Interviews mit Zeitzeugen geführt, auf das Instrument der oral history völlig verzichtet hat. Mischlers Buch ist mit rund 270 Textseiten konzise ausgefallen, ohne auf Substanz zu verzichten, was sich in knapp 1000 Fussnoten niederschlägt. Seine Quellen sind die einschlägige englischsprachige Sekundärliteratur sowie Zeitungsartikel. Das Resultat ist eine weitgehend ausgewogene Darstellung, die auf Schwarzweissmalerei verzichtet. In Ermangelung einer Alternative kann Mischlers Buch mit Abstrichen empfohlen werden. Dem Autor selbst sei die Lektüre liberaler und ordoliberaler Klassiker sowie liberaler Parteiprogramme empfohlen, was bei ihm zu Aha-Erlebnissen führen dürfte, denn neu an New Labour ist vor allem die Akzeptierung liberaler Rezepte, auch wenn das Mischler nicht wahrhaben will.
Mischler beschreibt auf Grund seiner Lektüren Blair als politisches Naturtalent, das als Jugendlicher auf der Bühne seiner Privatschule überzeugte, was ihm später in der Politik zugute kam. Als Bandleader interessierte sich der Teenager mehr für Mick Jagger und die Musik als für Politik. Blair dachte zudem einige Zeit ernsthaft daran, Priester zu werden und Gutes zu tun. Im Theologieunterricht diskutierte er eineinhalb Jahre den Sinn des Lebens und setzte sich mit der Philosophie des Schotten John Macmurray auseinander, der Christentum und Sozialismus miteinander zu verbinden suchte. Jahre später, am Ende seiner Studienzeit, reichte Blair das christliche Ethos nicht mehr. Um die Gesellschaft zu verändern, musste er in die Politik gehen.
Nach dem mit „gut plus“ abgeschlossenen Jurastudium zog er schon bald nach London, wo er dem Ortsverband Hackney der britischen Labourpartei beitrat. Nach dem Bestehen seiner Anwaltsprüfung 1976 ging er einige Monate nach Paris, wo er zuerst als Barkeeper, dann als Schreibkraft für französische Versicherungen tätig war. Erst danach zog es ihn in eine Anwaltskanzlei nach London. Nicht in irgendeine, sondern in die des Schotten Alexander Irvine. Der einflussreiche Anwalt in Diensten von Labour. Normalerweise nimmt normalerweise immer nur einen jungen Kollegen auf. Gerade erst hatte er Cherie Booth eingestellt, die an der London School of Economics als Beste ihres Jahrgangs abgeschlossen hatte. Doch Irvine erlag dem Charme Blairs, der die Stelle unbedingt haben wollte. Der Junganwalt verliebte sich rasch in seine junge Kollegin. Drei Jahre später heirateten sie.
Als Anwalt – wie schon in der Schule als Schauspieler – erwies sich Blair als Naturtalent, das komplexe Sachverhalte in kürzester Zeit zu durchdringen vermochte. In der Politik versuchte er sich 1982 in einem hoffnungslosen Wahlkreis und scheiterte mit nur 10% der Stimmen als abgeschlagener Dritter. Doch sein Einsatzfreudigkeit gefiel vielen Labour-Genossen. Bereits kurz nach der Wahl wandte sich Blair gegen die Parteilinke und deren Marxismus, gegen Verstaatlichungs- und Wiederverstaatlichungsprogramme. Noch ohne Erfolg, denn im Wahlprogramm von 1983 standen zudem noch Devisenkontrollen, Handelsschranken, Importquoten, festgelegte Preise und mehr auf der Agenda der Arbeiterpartei, die daher für die Mitte nicht wählbar war und auf die Oppositionsbänke verdammt blieb, wie Blair richtig erkannte.
Bereits 1983 erhielt Blair in einem anderen Wahlkreis erneut eine Chance. Diesmal konnte er sich zuerst innerhalb von Labour mit 42 zu 41 Stimmen als Kandidat durchsetzen – Mischler liefert leider keine Details dazu – und siegte danach an der Urne, sodass er am 9. Juni 1983 in Westminster einziehen konnte. Seine Partei hingegen erlitt eine dramatische Niederlage mit dem schlechtesten Resultat seit 1918. Mischler stellt nie die Frage, warum Blair überhaupt in eine solche Partei ging und nicht zum Beispiel zu den Liberalen.
Beim Einzug ins Unterhaus war Blairs erste Bekanntschaft die wichtigste, jene mit Gordon Brown, der seine Einschätzung der Labourpartei, ihrer Fehler und der nötigen Korrekturen teilte. Brown war mit 32 Jahren nach Blair der zweitjüngste Abgeordnete der Partei, konnte aber bereits auf eine Karriere als Hochschullehrer, Produzent und Leiter der Redaktion „Zeitgeschehen“ beim schottischen Fernsehen sowie als Vorsitzender der schottischen Labourpartei zurückblicken.
Blair bereitete sich auf jede Debatte, jede Rede und jede Anfrage in Westminster gründlich vor, denn er wusste, dass seine Karriere von seinen Unterhausauftritten abhing, bemerkt Mischler. Doch bis 1987 tat sich noch nicht genug in der Partei. Die Herren Blair und Brown fielen dem neuen Parteichef Neil Kinnock auf. Er verstand, dass er sie fördern musste und bat deshalb Blair im November 1984 in sein Büro. Blair zitterte, erinnerte sich Kinnocks Stabschef, Charles Clarke, denn er wusste nicht, dass er zum Sprecher für Finanz- und Wirtschaftsfragen im Schattenkabinett werden sollte.
Für die Öffentlichkeits- und Medienarbeit holte sich Kinnock Peter Mandelson an Bord. Blair freundete sich rasch mit dem ehemaligen Politredaktor des Londoner Fernsehsenders London Weekly Television an. Doch ein neues Image ohne neue Inhalte überzeugte die Wähler nicht. 1987 standen erneut die Forderung nach der „Kontrolle des Marktes durch die Gesellschaft“, staatliche Planung der Produktion und Umverteilung des Wohlstands im Labour-Programm. Immerhin, auf staatliche Preiskontrollen und einen Fünfjahresplan verzichtete die Partei inzwischen. Blair schaffte es, den Vorsprung in seinem Wahlkreis auf insgesamt 60% der Wahlerstimmen auszubauen. Labour hingegen gewann nur 3,2% hinzu und verharrte mit 30,8% in der Opposition.
Die Jungen wie Blair, Brown und Mandelson drängten auf Veränderung, da die alten Arbeiter-Wähler nicht mehr existierten. Auch Kinnock war dafür und gründete im September 1987 ein Policy Review genannte umfassende Revision des Parteiprogramms an. Die Resultate wurden am Labour-Parteitag 1989 vorgelegt. Die Forderung nach staatlicher Planwirtschaft, die Wiederverstaatlichung privatisierter Betriebe, Steuererhöhungen, Neuverschuldung und Protektionismus standen nicht mehr im Programm. Mit der Policy Review gelang es dem Parteivorsitzenden, den Einfluss des linken Parteiflügels und der Gewerkschaften zurückzudrängen und so selbst mehr Macht zu gewinnen. Der Parteivorstand und die Fraktionsführung im Unterhaus übernahmen das Ruder. Die Stärkung der Parteispitze erlaubte es Blair ab 1994, die Partei weiter in die politische Mitte zu führen. 1987 stieg Blair allerdings erst ein Treppchen in der Parteihierarchie auf. Er übernahm den Posten des Fraktionssprechers für Handels- und Industriefragen und wurde zum Energieminister im Schattenkabinett ernannt.
Mischler erwähnt hier mit keinem Wort Thatchers mit harten Bandagen geführten Kampf gegen die Gewerkschaften in den 1980er Jahren. Thatchers Standfestigkeit bei Streiks, insbesondere der Bergarbeiter, zehrte die Streik- bzw. Gewerkschaftskassen auf und schwächte die Gewerkschaften dauerhaft. Davon profitierte nicht nur Grossbritannien wirtschaftlich, sondern auch die Führung der Labourpartei, die unter Kinnock auf Reformkurs gehen wollte.
1992 gelang es Labour, den Torys 21 Mandate abzujagen, doch die Partei blieb auf die Oppositionsbänke verbannt. Blair und Brown trafen sich am Samstag nach der Wahl und kamen zum Schluss, dass Labour noch immer Positionen vertrat, die der Durchschnittswähler ablehnte. Brown verwies auf die im Wahlkampf geforderten höheren Steuern für Besserverdienende, um das Kindergeld und die staatlichen Renten zu erhöhen. Der Modernisierungskurs sollte fortgesetzt werden, doch Kinnock trat nach der Wahl zurück. Im Juli 1992 wurde John Smith Labours neuer Vorsitzender. Seine Positionen bedeuteten eine Rückkehr zu Positionen der 1970er Jahre. So machte er den Gewerkschaften weitgehende Zugeständnisse in Arbeitsrechtsfragen. Es war ein Schlag ins Gesicht der Reformer.
Doch Smith verstarb bereits 1994 an einem Herzinfarkt. Kinnock bezeichnete Blair als idealen Nachfolger. Torys bekannten, vor Blair hätten sie am meisten Angst. Labour-Parlamentarier meinten, Blair, inzwischen Schatten-Innenminister, habe die besten Aussichten, im traditionell konservativen Süden Englands Stimmen zu gewinnen. Presse und Parlamentarier arbeiteten für Blair. Doch auch Brown hatte Ambitionen. Erst nach drei spannungsreichen Wochen erklärte der Freund und Rivale, dass er sich nicht um den Parteivorsitz bewarb. Blair und Brown hatten sich am 31. Mai 1994 zu einem legendären Dinner im Restaurant Granita in Londons Stadtteil Islington getroffen. Über das Vier-Augen-Gespräch wird bis heute spekuliert. Blair soll Brown im Gegenzug zu seiner Wahl als Parteichef freie Hand in der Wirtschaftspolitik und das letzte Wort in der Sozialpolitik versprochen haben. Daneben sollte er Brown die Parteilinken John Prescott und Robin Cook vom Hals halten. Zudem halten sich seither – von Brown geschürte – Gerüchte, Blair habe Brown einen vorzeitigen Rückzug vom Premierministeramt zu seinen Gunsten versprochen.
Im Juli 1994 wurde Blair mit 57% der Stimmen zum Vorsitzenden der Labour Party gewählt. Zum Vergleich: Smith hatte 1992 überragende 91% erhalten. In seiner Antrittsrede bekannte sich Blair zum Modernisierungskurs von Kinnock und bezog klar Stellung gegen die Parteilinke. Gleichzeitig stellte sich Blair in die Tradition des Labour-Nachkriegspremiers Clement Attlee (1945-51): Damals wie heute sei ein Wiederaufbau nötig. Die Errungenschaften unter Attlee seien gewaltig: Demobilisierung und Vollbeschäftigung, Wohlfahrtsstaat und Nationaler Gesundheitsdienst. Diese Regierung mache ihn stolz, sich Sozialist zu nennen. Dabei verklärte er Attlees Regierungszeit, um sich so gegen die Parteilinke zu immunisieren. Mischler hätte durchaus noch herausstreichen können, dass die sozialistischen Rezepte Attlees zum wirtschaftlichen Abstieg Grossbritanniens beitrugen und der National Health Service bis heute eines der Sorgenkinder der britischen Politik ist. Presse wie Wähler reagierten euphorisch auf Blair und seine Rede. Der junge, telegene und rhetorisch beschlagene Labourführer lag bereits 1994 in Meinungsumfragen vor Premierminister John Major, den die Briten für engstirnig und unflexibel hielten, während dem Blair als kompetent, durchsetzungsstark und entscheidungsfreudig eingeschätzt wurde.
Auf dem Labour-Parteitag in Blackpool im Oktober 1994 deutete Blair an, dass er die „Clause IV“, den Paragrafen IV der Parteiverfassung aus dem Jahr 1918 abzuschaffen gedenke, der den Vorrang staatlichen Gemeinschaftseigentums vor Privatbesitz festschrieb. Doch die Parteimehrheit war damals noch nicht zu diesem Schritt bereit. Blair tourte durch ganz Grossbritannien, sprach an 35 Veranstaltungen zu insgesamt 30,000 Parteimitgliedern, um sie von seinen Argumenten zu überzeugen. Am 29. April 1995 war es endlich soweit, eine Mehrheit stimmte einer Änderung der „Clause IV“ auf einem Sonderparteitag zu.
Im Januar 1997 zog Blair mit einer programmatisch erneuerten Partei in die Unterhauswahlen. Er versprach, die Steuern in der kommenden Amtszeit nicht zu erhöhen. Der designierte Finanzminister Gordon Brown ging sogar soweit, für die ersten zwei Jahre der Legislaturperiode die Ausgabenpläne der Regierung Major zu übernehmen. Selbst Margaret Thatcher erklärte gegenüber dem Herausgeber der Times im Januar 1997 ihre Unterstützung für Blair. Das Boulevardblatt Sun, Thatchers einstige Hauspostille, schwenkte ebenfalls auf Blair ein. Zwei Monate später legte Major den Wahltermin auf den 1. Mai fest.
Blair veröffentlichte ein Manifesto for Business, mit dem er kleine Ladenbesitzer wie Vorstände grosser Konzerne zu gewinnen suchte. Mit Erfolg. Er traf sich regelmässig mit Wirtschaftsführern, die auch fleissig für Labours Wahlkampf spendeten. Die Torys erschienen derweil unfähig, das Land zu regieren. Leider unterlässt es Mischler, die Gründe für den Abstieg und desolaten Zustand der Torys in einigen Sätzen zu erläutern.
Im Wahlkampf erhielt Blair Schützenhilfe von Bill Clinton. 1993 war Blair zusammen mit Brown in die USA geflogen, um zu erfahren, wie es Clinton gelang, George Bush senior zu besiegen. Später trafen sich Blair und Clinton in der US-Botschaft in London zu einem Vier-Augen-Gespräch. Ein Jahr später wurde der Oppositionsführer in die USA eingeladen. Sie stellten übereinstimmende politische Ansichten fest und fanden sich zudem sympathisch. 1994 halfen Labour-Leute Clinton im Wahlkampf. 1997 revanchierte sich Clinton und entsandte Mitglieder seines Wahlkampfteams nach London und gab Blair zudem Ratschläge per Telefon.
Blairs Team und nicht die Tory-Regierung bestimmten die Tagesordnung des Wahlkampfs 1997. Alistair Campbell, ein Schulfreund Blairs und ehemaliger Journalist des Boulevardblatts Daily Mirror nahm die Konservativen unter Dauerbeschuss, erstellte fortlaufend Pressemitteilungen, Positionspapiere und Stellungnahmen. Jede Äusserung und Entscheidung von Premierminister Major wurde von Campbells Wahlkampftruppe in der Luft zerrissen. Labour gewann die Lufthoheit im Wahlkampf. Zusammen mit dem finanziellen Einsatz zahlten sich die Anstrengen aus, Labour gewann am 1. Mai 1997 herausragende 43,2% der Stimmen bzw. 418 Sitze und damit eine Mehrheit von 179 Mandaten. Die Konservativen erlitten mit 30,7% die grösste Schlappe seit der Entstehung des modernen britischen Parteiensystems im Jahr 1832.
Bereits im Vorwort übernimmt Mischler Blairs Gefasel vom Dritten Weg. Er bezeichnet Blairs Wirtschafts- und Sozialpolitik „einen dritten Weg zwischen ungezügelter und freier Marktwirtschaft und Bevormundung des Bürgers durch den Sozialstaat“. Mit der liberalen Ideengeschichte scheint er nicht vertraut zu sein, denn bereits im Vorwort schreibt er von weniger Staat, mehr Eigenverantwortung und Eigeninitiative, ignorierend, dass dies uralte liberale Schlagworte und Rezepte sind, die zum Beispiel Ende der 1970er Jahre von der deutschen und der schweizerischen FDP mit mässigem Erfolg, von Reagan und Thatcher im angelsächsischen Raum mit etwas mehr Durchschlagskraft propagiert wurden.
Im Kapitel zu „Blairs Innenpolitik des Dritten Wegs“ erwähnt Mischler die unbestreitbaren Erfolge des Premierministers. So zum Beispiel das – liberale – Rezept, nicht einfach Geld an Arbeitslose zu verteilen, sondern dafür eine Gegenleistung zu verlangen, was zu einer spürbaren Reduktion der Arbeitslosigkeit führte, wovon Deutschland nur träumen kann. Gleichzeitig fuhr Gordon Brown ein Sparprogramm, wodurch er beim Platzen der New-Economy-Blase genug Geld in der Kasse hatte, um den globalen Abschwung mit gesteigerten Staatsausgaben abzufedern. Doch Mischler vermerkt zurecht kritisch, dass das Sparprogramm die dringend benötigten Reformen im Gesundheits- und Bildungswesen sowie bei der Verkehrsinfrastruktur verhinderte.
Mischler erklärt, dass der Dritte Weg, der Spagat zwischen marktwirtschaftlichem Liberalismus und sozialer Gerechtigkeit, schwer zu verstehen sei. Der freie Markt und prosperierende Unternehmen stünden im Zentrum von Blairs Wirtschafts- und Sozialpolitik. Die Umverteilung von Wohlstand gehöre nicht zu den Mitteln des Premiers. Daher behaupteten die Torys, es gebe im Denken Blair nichts, dass er nicht aus den politischen Leitsätzen Margret Thatchers aufgegriffen hätte. Doch das sei ein politisches Feigenblatt, um die schmerzliche politische Niederlage zu kaschieren. Anthony Giddens nenne zwar Blair den „grössten Tory seit Thatcher“, doch weise er auch auf den anderen Blair hin, den radikalen Freidenker, „der sich weit über den normalen Bereich von links und rechts hinaus engagiert“ und Konzepte wie Gleichheit und Gerechtigkeit von Grund auf neu definiere. Mischler behauptet, Blair sei weder konservativ noch liberal. Der Premier lasse sich ideologisch nicht fassen. Zudem zitiert er aus Blairs Interviews und Aufsätzen, in denen er erklärte, keinen „politischen Guru“ zu haben. Beeinflusst sei er von Sören Kierkegaard, Carl Gustav Jung, Immanuel Kant und John Macmurray, zu einer Anthologie dessen Schriften Blair ein Vorwort verfasste. Blair bekannte selbst: „Wenn ich vom Dritten Weg spreche, gibt es keine vorgefasste Haltung, keine vorher festgelegten Mittel oder Vetorechte. Was zählt, ist das, was funktioniert.“ Doch damit macht es sich Mischler zu einfach. Denn neu an New Labour sind vor allem die Übernahme von liberalen und ordoliberalen Rezepten und die Abkehr von sozialistischen Träumereien.
Mischler führt an, dass Blair aus dem Christentum den Glauben beziehe, dass sich der Einzelne sich selbst und der Gesellschaft gegenüber verpflichtet sei. Blair habe eine Wohlfahrtstheorie entwickelt, die den einzelnen zu Eigenverantwortung und den Staat dazu verpflichtet, den Bürger in die Lage zu versetzen, für sich selbst sorgen zu können. Doch das sind erneut liberale Grundsätze. Blair erläuterte zudem, dass (sein) Sozialismus „für Gleichheit [steht], nicht weil er will, dass alle Menschen genau gleich sind, sondern weil wir unsere Individualität nur unter gleichen wirtschaftlichen Bedingungen wirklich entwickeln können.“ Diese moralische Grundlage sei das einzige, was nach dem Ende des real existierenden Sozialismus, dem Sieg des freien Marktes über die staatliche Planwirtschaft, noch zähle.
Mischler wendet sich erneut gegen den Vorwurf, Blairs Politik sei toryistisch: „Der Premier lehnt die sozialistischen Werte seiner Partei keineswegs rundheraus ab. Er will sie nur modern verstand und angewandt wissen und ihnen wieder zu der Geltung verhelfen, die sie seiner Meinung nach verloren haben.“ Er zitiert Blair, der darauf verweist, dass die Werte der Labour Party jene seien, welche „fortschrittliche Politiker zu jeder Zeit hatten“. Konkret erläutert Blair: „Die gleichen Werte, die auch die grossen liberalen Reformer des 19. und 20. Jahrhunderts teilten oder die Labour-Helden von 1945: der Glaube an soziale Gerechtigkeit, Chancengleichheit, Freiheit; der Glaube daran, dass der Einzelne in einer starken Gemeinschaft und in der Gesellschaft anderer am besten fährt.“ Na ja, Chancengleichheit und Freiheit sind liberale Postulate, die mit sozialistischer „Gerechtigkeit“ allerdings unvereinbar sind und von der sich Blair ja auch klar abgewandt hat.
Mischler zitiert Blair mit den Worten: „Der wahre Sozialismus sei keine gegen die Wirtschaft und den freien Markt gerichtete Kampfideologie, sondern eine Gesellschaftslehre, die die Wohlfahrt des Einzelnen in ihren Mittelpunkt stellte.“ A bold statement, wann man die sozialistische und sozialdemokratische Politik seit Marx untersucht.
1990 antwortete Blair in einem Interview mit Marxism Today, am stärksten beeinflusst habe ihn Peter Thomson, Prinzipal des St. Mark’s College in Adelaide. Thomson empfahl Blair die Lektüre des schottischen Moralphilosophen und Theologen John Macmurray, der in den 1930er Jahren Marx‘ frühe Schriften übersetzte und seine Philosophie als Reaktion auf den Marxismus entwickelte. Anders als der Marxismus lehnt Macmurray Politik als Mittel der Konfliktlösung ab. Familie und Gemeinden bilden seiner Meinung nach den Kern des gesellschaftlichen Zusammenlebens, in dem sich Menschen in Eigenregie gegenseitig helfen. Der Mensch lebe nur in und durch seine Beziehung zu anderen. Der Liberalismus hingegen baue auf der Idee auf, dass der Einzelne die Freiheit und das Recht habe, alles zu tun, worauf er Lust habe. Doch das ist falsch, was weder Macmurray noch Mischler zu wissen scheinen. In der liberalen Welt endet die Freiheit des Einzelnen dort, wo die Freiheit des Nächsten beginnt.
Laut Mischler übernimmt Blair von Macmurray vor allem das Gemeinschaftskonzept. Menschen suchen die Gemeinschaft, partnerschaftliche Beziehungen, weil sie so besser gegen die Kräfte des Wandels und die Unsicherheit in der modernen Welt gerüstet seien. Doch um in einer Gemeinschaft leben zu können, müsse sich der Einzelne seiner Verantwortung und Pflichten bewusst sein. Mischler verweist auf Giddens, der den Kern von Blairs Ideenwelt und Politik des Dritten Wegs als „keine Rechte ohne Verpflichtungen“ beschrieb. Arbeitslosenunterstützung sei an die Verpflichtung des Empfängers gebunden, aktiv nach einer neuen Stelle zu suchen. Blair liberalisierte zudem den Arbeitsmarkt. All diese Ideen scheinen aus liberalen Wahlprogrammen abgeschrieben zu sein, was Mischler scheinbar erneut entgeht.
Zurück zur Alltagspolitik. Im September 1997 stieg Blairs Beliebtheit noch höher, weil er beim Unfalltod von Prinzessin Diana am 30. August anders als die Königin richtig reagierte und die Gefühle seiner Landsleute richtig einschätzte, als er in einer Rede festhielt: „Menschen überall auf der Welt… liebten sie, sahen sie als eine der ihren. Sie war die Prinzessin des Volks und wird es bleiben.“ Prinz Charles soll seine Mutter angeschrieen haben, sie solle sich endlich in der Öffentlichkeit zeigen. Blair behielt einen kühlen Kopf, reiste nach Schottland und bewegte die Königin, nach London zurückzukehren. Als der Hof eine private Beerdingung wollte, gibt Blair zu verstehen, dass dies die Monarchie in ernste Schwierigkeiten bringen würde und beauftragte Alistair Campbell mit den Vorbereitungen für ein Staatsbegräbnis. Blair selbst sprach damals von einem „Volksbegräbnis“. Mischler hätte anfügen können, dass Diana aus höchsten Adelskreisen stammte, also mitnichten eine Prinzessin aus dem Volk war.
Die neue Regierung entfaltete sofort rege Aktivität. Blair baute zuerst die Schaltzentrale seiner Macht um und besetzte selbst in den Ministerien Schlüsselstellen mit Mitarbeitern, die das Vertrauen der Regierung besassen, was viele Ministerialbeamte vor den Kopf stiess. Blair traute niemandem. Selbst einige Kabinettsmitglieder seien ihm suspekt. Noch bevor das neue Parlament zusammengetreten war, entliess Blair die Nationalbank in die Unabhängigkeit. Ebenfalls noch 1997 gab er den Schotten und Walisern die versprochenen eigenen Volksvertretungen. Zurecht kritisch vermerkt Mischler, dass der Enthusiasmus der Waliser begrenzt war, denn im Gegensatz zu den Schotten erhielten sie nur die Befugnis, über Ausführungsbestimmungen zu in Westminster verabschiedeten Rahmengesetzen zu begrenzten Themen zu verabschieden. In London wurde das Westminster-Oberhaus gestutzt, aber nicht abgeschafft.
2001 wurde Blair wieder gewählt, doch viele Wahlversprechen hatte er noch nicht umgesetzt. Das Bildungs- und Gesundheitswesen und das marode Schienennetz warteten noch immer auf substantielle Besserungen. Ein Streik der Lastwagenfahrer sowie die Maul- und Klauenseuche belasteten das Image der Regierung bereits vor der Wahl. 2002 liess die Begeisterung der Briten für Blair wegen dem diplomatischen Vorspiel zum Irakkrieg und Blairs immer engeren Anlehnung an Bush zusätzlich nach. Peinlich war im Winter 2002/2003, dass die Regierung ihr Irakdossier weitgehend einer zehn Jahre alten Doktorarbeit aus dem Internet abgeschrieben hatte. „Blairs Image nimmt einen nicht wieder gutzumachenden Schaden“, konstatiert Mischler. Zudem gelang es ihm nicht, im Februar und März 2003 den UN-Sicherheitsrat zur Verabschiedung einer zweiten Irakresolution zu bewegen, die einen Irakkrieg eindeutig legitimiert hätte. Im Juni 2003 nahm sich der Waffenexperte David Kelly das Leben und die britischen und amerikanischen Soldaten fanden im Irak keine Massenvernichtungswaffen. Immer mehr Briten kamen daher zum Schluss, Blair sei ein Lügner, an dessen Händen Blut klebe.
Auf dem Parteitag in Bournemouth im September 2003 schlug Blair Hass und Misstrauen wie noch nie entgegen. Der Parteiführer stellte geschickt die rhetorische Frage, „aufgeben oder weitermachen?“ und brachte so, dank seiner „mitreissenden schauspielerischen Begabung“, die Delegierten wieder auf seine Seite. Doch in den Ortsverbänden sah es anders aus. Die Mitgliederzahl schrumpfte. Viele wünschen sich vor der nächsten Wahl, die spätestens 2006 stattfinden sollte, einen Wechsel an der Parteispitze.
Doch Blair konnte auch Erfolge aufweisen. Die Arbeitslosigkeit war 2004 so niedrig wie seit 1975 nicht mehr. Die Warteschlangen in den Spitälern waren nicht mehr ganz so lang wie zuvor, der Service der öffentlichen Dienste hatte sich gebessert und die Wirtschaft entwickelte sich besser als alle anderen in Westeuropa. Dennoch erhielt Labour bei den Kommunalwahlen vom 10. Juni 2004 einen Denkzettel und landete mit lediglich 26% der Stimmen hinter den Liberalen mit 30% und den Torys mit 38% auf dem dritten Platz. So etwas war einer Regierungspartei in Grossbritannien noch nie passiert. Bei den Europawahlen drei Tage später erhielt Labour gar nur 22%.
Die Spannungen zwischen Blair und Schatzkanzler Gordon Brown nahmen 2004 zu. Bei der Kabinettsumbildung stiess der Premier seinen längst zum Rivalen avancierten Mitstreiter vor den Kopf, indem er dessen Intimfeind Alan Milburn in die Regierung holte. Milburn sollte die für die Wahlkampfstrategie 2005 verantwortliche Kommission leiten. Zurück vom Parteitag 2004 erklärte Blair zudem den englischen Fernsehsendern, er werde die volle dritte Amtszeit durchregieren, ehe er abtrete, was Brown sauer aufgestossen haben muss. Die Rivalität schlug im Vorfeld der Unterhauswahlen von Sommer 2005 in Feindschaft um.
Mischler wehrt sich gegen den Eindruck, Margaret Thatcher habe von 1979 bis 1990 so viel Erfolg mit ihrer Wirtschaftspolitik gehabt, dass diese als Vorbild für die Bundesrepublik gelten könne. Er verweist darauf, dass der britische Wirtschaftsboom erst unter John Major einsetzte und sich erst unter Tony Blair zur Gänze entfaltete. Im Wahlkampf 1997 erinnerte Blair wiederholt die Wähler daran, dass die Torys 1980 und 1981 sowie zwischen 1990 und 1992 Grossbritannien in zwei grosse Rezessionen getrieben haben, indem sie zuerst stur an festen Geldmengen-Zielvorgaben und danach an den Vorgaben für den Wechselkurs des britischen Pfunds festhielten. Von 1979 bis 1988 wuchs die britische Wirtschaft jährlich nur um 1,9%, von 1988 bis 1997 gar nur um 1,5% jährlich. Laut Mischler schlug die Mischung aus Haushaltsdisziplin und Kontrolle von Geldmenge und Inflation fehl.
Zu Beginn der Ära Thatcher wurde durch die Regierungspolitik das Pfund in die Höhe getrieben, durch die höheren Preise sank die internationale Konkurrenzfähigkeit britischer Firmen, das Bruttoinlandprodukt schrumpfte gar um 2,3% und die Arbeitslosigkeit verdoppelte sich auf 9,9% der Erwerbsbevölkerung. Mitte der 1980er Jahre erholte sich die Wirtschaft von diesem Einbruch, 1987 und 1988 folgte gar ein leichter Boom. Doch in dieser Situation senkte Thatchers Finanzminister Lawson die Steuern und Zinsen, wodurch die Wirtschaft sich endgültig überhitzte. Da griff Lawson zur Notbremse und erhöhte innerhalb von zwei Monaten die Zinsen von 7,5% auf 12%. Als die Briten trotzdem weiter kräftig einkaufen gingen, erhöhte er im Herbst 1989 die Zinsen nochmals um 3%. Mischler schliesst daraus nicht zu unrecht: „Dieser Wirtschaftspolitik fehlte jeder Sinn und Verstand.“ Sie führte zum Rücktritt von Lawson, der durch John Major ersetzt wurde. 1990 und 1991 glitt die Wirtschaft erneut in eine Rezession ab. An der Arbeitslosenfront verzeichnete Thatcher Mitte der 1980er Jahren 11% Arbeitslose. Selbst während der Boomphase 1987-88 sank die Rate nur auf 7,6%. Zudem lebten 1992 ganze 14,1 Millionen Briten in Armut, dreimal so viele wie 1979.
Die Ausgaben für die Soziale Sicherheit und das Gesundheitswesen stiegen unter Thatcher um 30%, obwohl sie mit allen Mitteln ihr Budget – vor allem im Sozialbereich – zu kürzen suchte. Dabei ging sie kreative Wege und bot Bewohnern von Sozialwohnungen, diese zu kaufen, sparte so der öffentlichen Hand die Unterhaltskosten. Arbeitslose mussten höhere Anforderungen erfüllen, ehe sie Unterstützung erhielten. Die Sozialämter wurden angewiesen, die Vermögensverhältnisse der Antragsteller kritisch zu prüfen. Der Grossteil dieser Massnahmen habe das Sozialbudget nicht entlastet, sei zu spät, dann zu hastig und unüberlegt durchgeführt worden, sodass viele Reformen zurückgenommen oder grundlegend geändert werden mussten. Allerdings klingt dem Schreibenden vieles daran vernünftig.
Mischler erwähnt die Deregulierung des Arbeitsmarktes als einzigen nachhaltigen Erfolg Margaret Thatchers. Sie sei dabei „besonders rabiat gegen die Arbeitnehmervertreter“ vorgegangen. Der Autor scheint Thatchers Zerschlagung der Gewerkschaftsmacht in einem fast schon epischen Kampf zu unterschätzen. Er legte nicht nur eine der Grundvoraussetzungen für den Boom unter Blair – was Mischler zwar anerkennt und die Massnahmen auch im Detail aufzählt -, sondern er forderte eine Standfestigkeit und Härte, wie sie kaum ein Politiker in Friedenszeiten je an den Tag gelegt hat.
Major profitierte laut Mischler von einem Zufall: Um die internationale Finanzspekulation gegen das Pfund abzuwehren, trat Grossbritannien 1992 aus dem EWS aus. Das Pfund konnte nun abgewertet werden. Britische Produkte wurden im Ausland günstiger. Die Exporte stiegen. Arbeitslosigkeit und Inflation im Inland sanken. Mischler hält fest, dass „zwischen 1992 bis 1997 … sich die britische Wirtschaft schliesslich so [entwickelte], wie es heute bewundernd von Deutschland aus wahrgenommen wird.“ Die Inflation sank auf 2%, die Arbeitslosenrate halbierte sich auf 5,8%. Nach 1994 wuchs die Wirtschaft jährlich um 3%.
Da stellt sich die Frage, warum Major 1997 gegen Blair keine Chance hatte. Mischler erklärt, dass Blair und Brown die gleichen wirtschaftspolitischen Ziele wie Thatcher und Major verfolgten. Sie wollten die Finanzstabilität Britanniens durch eine geringe Inflation und die Kontrolle der Geldmenge garantieren. Der freie Markt stand im Zentrum von Blairs Wirtschaftsprogramm, der zudem erkannte, dass die Briten ihre Produktivität im internationalen Vergleich steigern mussten. Daher galt und gilt es, die mangelhafte Infrastruktur zu verbessern, Investitionen in Forschung und Entwicklung sowie die Aus- und Weiterbildung zu erhöhen. Ein wesentlicher Schritt war die sofortige Entlassung der Zentralbank in die Unabhängigkeit nach dem Wahlsieg 1997, was Unternehmer, insbesondere die Finanzbranche der City begeisterte. Damit wollten Blair und Brown den Teufelskreis aus Boom- und Bust-Phasen überwinden.
Noch vor der Wahl gaben Blair und Brown den Wählern das Gefühl, ihnen vertrauen zu können. Diesen Punkt hätte Mischler durchaus ausbauen können, denn die Psychologie ist ein entscheidender, zumeist unterschätzter Faktor: Vertrauen in die Regierung und in die Zukunft ist nicht nur an den Märkten, sondern in der gesamten Volkswirtschaft, bei Konsumenten und Wählern ein Schlüsselfaktor. In den ersten zwei Regierungsjahren senkte Gordon Brown die Körperschaftssteuer und die Mehrwertsteuer auf Benzin. Die Staatsausgaben sanken von 41% auf 38%, den niedrigsten Wert seit 1964. Die strenge Haushaltsdisziplin wurde dank einer rigorosen Dreijahresplanung in allen Ministerien, die im Kabinett verteidigt werden musste, eingehalten. Auf der Einnahmenseite wurden zum Beispiel eine Windfall Tax auf die Gewinne der besonders profitablen privatisierten Versorgungsunternehmen eingeführt und die indirekten Steuern, so auf Tabak, wurden erhöht. Die Durchschnittssteuerlast sank dennoch von 23% auf 22%, den niedrigsten mittleren Steuersatz, den Grossbritannien je kannte. Nach dem Erwirtschaften eines Haushaltüberschusses reagierte Brown auf das Platzen der Aktienblase im Frühsommer 2000 mit weiteren Ausgabensteigerungen. Das Haushaltsdefizit sieg mit 3,3% über die von der EU festgesetzte Grenze, doch sichert der Schatzkanzler so die britische Wirtschaft erfolgreich gegen die Wirtschaftsflaute ab, welche die anderen Industrieländer in den folgenden Jahren heimsuchte. 2000 wuchs die britische Wirtschaft um satte 3%, im Wahljahr 2001 immerhin noch um 2,5%. Von einer Krise wie im Rest Westeuropas konnte keine Rede sein. Im März 2001 waren zudem lediglich 3,4% der Briten auf Arbeitssuche. Es war die niedrigste Arbeitslosenrate seit 1974.
Die Situation in den Krankenhäusern blieb allerdings weiterhin desolat, das Schienennetz veraltet, die Züge blieben häufig verspätet, Schulen und Universitäten überfüllt. Brown musste von der Haushaltsdisziplin etwas abrücken. Dies war möglich, weil dank dem Abbau der Staatsschulden die Zinslast gesunken war. Britannien boomte weiter, sodass Brown Mitte Juni 2004 mitteilen konnte, Britannien erlebe die längste Wachstumsphase seit Beginn der industriellen Revolution.
Obwohl Blair und Brown die Wirtschaftspolitik ihrer Vorgänger fortführten, sind die Briten mit New Labour glücklicher, denn erst jetzt entfaltete sich der unter John Major einsetzende Aufschwung voll. Blair versteht es zudem besser, seine Wirtschaftspolitik zu verkaufen. Das ist auch leicht zu vermitteln, da im ersten Quartal 2004 die britischen Gehälter um 5,2% stiegen. 2002 allein erhöhten sich die Hauspreise um 16,6 bis 20,3%, je nach Lage. Im Land der Hausbesitzer trug das wesentlich zur Einschätzung der eigenen wirtschaftlichen Potenz bei. Im Gegensatz zu Deutschland ist in Grossbritannien das Verbrauchervertrauen intakt, obwohl Konsumgüter auf der Insel rund 20% teurer sind als in Kontinentaleuropa. Doch das stört nur die Touristen. Insbesondere in London werden seit Ende der 1990er Jahre Gehälter in bisher unbekannter Grösse bezahlt. Die Verschuldung der Haushalte erreichte allerdings 2004 gefährliche 102% des BIP. Die Briten stehen durchschnittlich mit 130% ihrer Jahreseinkommen in der Kreide.
Blairs Sozialpolitik des New Deal beruht auf dem Prinzip „keine Rechte ohne Pflichten“. Wer nicht kooperiert, verliert den Anspruch auf Unterstützung. Welfare to Work beruht wie so viele Ansätze Blairs auf mehr Eigenverantwortung der Bürger und Arbeitnehmer, ein klassisch-liberaler Grundsatz, was Mischler ignoriert. Blair weigerte sich, die restriktiven Gewerkschaftsgesetze der Torys abzuschaffen. Er wollte den Arbeitsmarkt nicht neu regulieren, sondern ihn im Gegenteil noch flexibler gestalten. Hingegen setzte er sich für faire Arbeitsbedingungen und die Grundrechte der Arbeitnehmer ein. Dazu gehörte die Einführung eines Mindestlohns. Blair schaffte es, die strukturelle Arbeitslosigkeit abzubauen.
„Der Wohltäter“ nennt Mischler das Kapitel zu „Blairs humanitären Kriegen“. Der hämische Unterton findet im Text nur teilweise seine Entsprechung. Der Autor konzediert Blair und Aussenminister Cook durchaus eine ethische Dimension der Aussenpolitik des „Dritten Wegs“. Dazu gehören Gerechtigkeit, Menschenrechte und die moralische Pflicht, den ärmsten Staaten zu mehr Wohlstand zu verhelfen. An diese Prinzipien glaube „der Mensch und Politiker Blair fest“, so Mischler. Die Entwicklungshilfe für Afrika und den Krieg im Kosovo erhebe er deshalb „zu seinem persönlichen Feldzug“. Im Kosovo genauso wie später in Afghanistan wollte er mehr als nur Flagge zeigen.
Bis zu seinem Wahlsieg war für Blair die Aussenpolitik unbedeutend. Einmal im Amt, setzten sich Blair und Cook für das Ottawa-Abkommen ein, das die Produktion und den Handel von Landminen verbietet, und für einen internationalen Strafgerichtshof ein. Doch gleichzeitig unterstützten sie die britische Rüstungsindustrie und stornierten die indonesische Bestellung von Kampfflugzeugen erst nach langem Zögern, obwohl Indonesien nach den Wahlen in Ost-Timor brutal gegen die Opposition auf der Insel vorgegangen war. Die britische Firma Sandline International Waffen konnte Waffen an eine Bürgerkriegspartei in Sierra Leone liefern. Blair gab wiederholt der Waffenlobby nach und fuhr seinem Aussenminister in die Parade, so Mischler, weil Tausende von Arbeitsplätzen davon abhingen. Blair und Cook entfremden sich in der Folge zunehmend wegen der „ethischen“ Aussenpolitik des Aussenministers.
Blair befürwortet humanitäre Kriege. Im April 1999 lieferte er in seiner Rede „Doktrin der internationalen Gemeinschaft“ eine Antwort auf die Frage, wann eine Intervention in einem anderen Land – was die Verletzung seiner Souveränität und der Unverletzlichkeit seiner Grenzen bedeutet – gerechtfertigt sei. In dieser Rede zum 50jährigen Jubiläum der NATO in den USA erklärte er, dass eine Intervention gerechtfertigt sei, wenn ein Staat Völkermord betreibe oder die Menschenrechte so verletze, dass er Flüchtlingsströme auslöse, die den Frieden und die Stabilität der betroffenen Region bedrohten. Blair leitete dies aus den historischen Erfahrungen des 20. Jahrhunderts her.
Doch mit seiner angriffslustigen Haltung vergrätzte Blair früh Frankreich und Deutschland, die nicht durch eine ethisch motivierte Aussenpolitik in Konflikte weltweit hingezogen werden wollten, die sich Downing Street aussuchte. Hierzu muss man Mischler entgegnen, dass Chirac laut der französischen Presse noch im Dezember vor dem Irakkrieg von Bush junior eine symbolische Entsendung von Flugzeugen erwog, seine Meinung aber unter dem Eindruck von Umfragen änderte.
Blair und Cook forderten ein Eingreifen im Kosovo gegen den Rat der Rechtsexperten im Aussenministerium, die Bedenken hatten, da der Konflikt innerhalb der Republik Jugoslawien stattfand. Zudem handelte es sich um den ersten Krieg der NATO ohne UNO-Mandat. Zuerst führte der Krieg nicht zum Erfolg, da die Luftangriffe Milosevic nicht hart genug trafen. Es kam im Gegenteil zu ethnischen Säuberungen mit rund 100,000 Toten sowie Folter, Vergewaltigungen und der Vertreibung von über 860,000 Menschen aus dem Kosovo. Innerhalb des Kosovo waren zudem nochmals 590,000 Flüchtlinge zu zählen. Clinton war damals bereits durch die Lewinsky-Affäre geschwächt und wäre ein grosse Risiko eingegangen, amerikanische Soldatenleben auf dem Balkan in einem Konflikt zu riskieren, für den sich in seinem Land kaum jemand interessierte.
Bereits vor dem Krieg hatten die Liberaldemokraten und Torys Blair vorgehalten, dass nur ein Bodenkrieg zum Ziel führe. Ende März 1999 drehte die Stimmung bei der britischen Bevölkerung. 70% gaben in einer Umfrage an, es sei dumm von den Amerikanern, den Einsatz von Bodentruppen kategorisch abzulehnen. Blair nahm diese Bedenken erst Ende April ernst und forderte nun von den USA den Einsatz von Bodentruppen. Durch Anrufe konnte Blair Clinton nicht umstimmen. Er nutzte die Feierlichkeiten zum 50. NATO-Jubiläum, um Clinton mehrfach persönlich zu treffen. Bei einem der festgefahrenen Gespräche ging Blair nach rund einer halben Stunde auf die Toilette. Clinton folgte kurz darauf seinem Freund. Nach einer Viertelstunde kehrten sie zusammen zurück. Auf der Toilette hatten sie einen Kompromiss geschlossen. Clinton setzte durch, dass er den Bodenangriff der Öffentlichkeit nicht ausdrücklich ankündigen könne, doch der NATO-Generalsekretär Javier Solana solle mit den Planungen für eine Landoffensive der NATO beauftragt werden, die tatsächlich Ende April begannen.
Premierminister D’Alema in Italien war vorerst gegen den Einsatz von Bodentruppen. Kanzler Schröder hielt ihren Einsatz für „undenkbar“. Selbst Clinton änderte erst im Juni 1999 öffentlich seine Meinung. Die Briten entsandten daraufhin 50,000 Mann nach Jugoslawien. Einen Tag später knickten die Serben ein. Leider ist die Bilanz des Einsatzes durchzogen, nicht zuletzt weil heute die Arbeitslosigkeit im Kosovo bei deprimierenden 75% liegt, sich die Bevölkerung nicht selbst helfen kann, wie Mischler festhält.
Nach Sierra Leone sandte Blair 1999 700 Soldaten, danach Flugzeuge, Helikopter, Kriegsschiffe und 800 Royal Marines, nachdem die Lage im dortigen Bürgerkrieg mehrfach trotz Vermittlung von Robin Cook aus dem Ruder gelaufen war. 11,000 UNO-Blauhelme aus Afrika, Asien und Arabien konnten den Frieden dort nicht nachhaltig sichern. Im Jahr 2000 wurden die Briten immer stärker in den Bürgerkrieg hineingerissen. Blair entsandte weitere 500 Marines. Der Einsatz lohnte sich, denn 500,000 Flüchtlinge konnten so in ihre Dörfer zurückkehren. Blairs Interesse an Afrika endete danach nicht. Die Entwicklungsministerin Claire Short übernahm im Herbst 2000 die Leitung eines Kabinettsausschusses für Afrika. 1997 war Short in ihrem neueingerichteten Ministerium sofort daran gegangen, ein sechs Monate später veröffentlichtes Weissbuch mit dem Titel „Beseitigen wir die Armut auf der Welt. Eine Herausforderung für das 21. Jahrhundert“ auszuarbeiten, dem sie Taten folgen lassen wollte. Dabei handelte es sich um das erste britische Entwicklungshilfe-Konzept seit 1975. Bis 2004 verdoppelte sich das Budget von Shorts Ministerium auf 4,5 Milliarden Pfund. Die Gelder wurden zudem besser als zuvor eingesetzt, und Brown schrieb 1999 die bilateralen Anleihen der ärmsten 41 Staaten ab, immerhin 640 Millionen Pfund.
Nach dem zweiten Wahlsieg erklärte Blair auf dem Labour Parteitag im Oktober 2001: „Afrikas Zustand ist ein Schandfleck auf dem Gewissen der Welt.“ Diesen „Makel“ wollte er beheben, denn sonst werde die „Narbe tiefer und bösartiger.“ Doch weder in Simbabwe noch im sudanesischen Darfur konnte sich der Premier zum Eingreifen durchringen. Blair und Aussenminister Jack Straw erhoben lediglich den moralischen Zeigefinger. Die fehlende Zustimmung im Irakkrieg beraubte sie 2004 jeder Handlungsmöglichkeit im Sudan, behauptet Mischler.
Bezüglich dem Irakkrieg meint der Autor, Blair folge Bush nicht als willenloser Vasall, sondern weil er überzeugt sei, dass sich ein Feldzug gegen Saddam Hussein nicht vermeiden lasse, wenn der Westen in Ruhe und Frieden leben wolle. Blair glaubte vor und während des Feldzugs, dass der Irak biologische und chemische Massenvernichtungswaffen besitze und diese selbst gegen den Westen einsetzen oder diese an Terrororganisationen weitergeben könne. Präventivschläge hält Blair für legitim, sich auf die vom britischen Diplomaten Robert Cooper inspirierte Ideologie des „Neuen Kolonialismus“ stützend, mit der Blair das Recht begründet, sich gegen den Terror zu verteidigen. Der ethische Ansatz, den Blair im Afghanistanfeldzug zumindest noch Ansatzweise verfolgt habe, wurde durch den aggressiven „Neuen Kolonialismus“ ersetzt, so Mischler.
Neben dem Schutz des Westens ist Blairs zweites Motiv, sich an der Seite der USA zu engagieren, die Angst, die USA könnten sich im Alleingang an den Attentätern rächen. Der Premier ist der Meinung, dass die Welt nur dann in Frieden leben könne, wenn alle Nationen eng miteinander verbunden sind. Blair sitzt dem „Irrglauben“ auf, so Mischler, Washington zu einem Krieg gegen den Terrorismus und einen Irakfeldzug im Rahmen und mit der durch die UNO ausgedrückten Zustimmung der Staatengemeinschaft überzeugen zu können. In diesem Zusammenhang schreibt er von „neokonservativen Kriegstreibern“.
Als die Terroristen am 11. September 2001 in den USA zuschlugen, sagte Blair eine Rede in Brighton ab und reiste zurück nach London, wo er gegen 17 Uhr vor Downing Street 10 den USA seine uneingeschränkte Unterstützung zusagte: „Hier handelt es sich nicht um eine Schlacht zwischen den Vereinigten Staaten von Amerika und dem Terrorismus, sondern zwischen der freien und demokratischen Welt und dem Terrorismus.“ Blair gestand später, dass 9/11 für ihn „eine Enthüllung“ war. Es handele sich um eine Kriegserklärung religiöser Fanatiker, die bereit seien, den Krieg ins Grenzenlose zu treiben. Sie hätten auch 300,000 statt nur 3,000 töten können. Sie wollten soviel Hass zwischen Moslems und dem Westen schüren, dass ein religiöser Dschihad Realität werde und die Welt verschlucke.
Der Diplomat Robert Cooper war damals Büroleiter von Javier Solana. Er forderte in seinen Aufsätzen einen Neuen Imperialismus. Blair war von den Schriften so angetan, dass er nicht nur ein Vorwort zu dem von Cooper angeregten Aufsatzband Re-Ordering the World verfasste, sondern sogar einen Beitrag beisteuerte (Hg. Mark Leonhard: London, 2002). Cooper hatte seinen für Blair wegweisenden Essay The New Imperialism vor dem 11. September 2001 verfasst, aber erst danach veröffentlicht. Der Sphäre des Chaos und der Barbarei stehe das Reich der Zivilisation gegenüber. Das sei schon in der Antike so gewesen, schreibt Cooper. Heute sehe er vor allem zwei Typen von Staaten: Erstens die „vor-modernen“, oft ehemalige Kolonien, in denen der Staat kaum mehr existiere und wie bei Hobbes jeder gegen jeden Krieg führe. Dazu zählte er Afghanistan, Burma, fast ganz Afrika, allgemein Drogen anbauende Staaten. Diese Staaten hätten ihre Legitimation oder ihr Monopol verloren, weshalb sie zu schwach gegenüber Terroristen und Drogenbanden seien. Von ihnen aus gehe die grösste Bedrohung für die nachfolgende Staatengruppe aus. Diese zweite Gruppe bilden die post-imperialistischen, postmodernen Staaten, die nicht mehr an Eroberungen dächten, wenn sie sich mit ihrer Sicherheit beschäftigten; dazu zählt Cooper Grossbritannien und die restlichen europäischen Staaten sowie Kanada und Japan, die sich gegenseitig überwachten. Die EU mischten sich innerhalb der EU in die Angelegenheiten der anderen. Cooper erwähnt noch eine dritte Gruppe, die traditionellen „modernen“ Staaten, die sich verhalten, wie sich Staaten schon immer verhalten hätten, der Staatsräson und den Prinzipien Machiavellis folgend. Bei den USA ist sich Cooper nicht sicher, ob es sich nicht um einen „modernen“ Staat handelt, der als solcher eine Bedrohung für die postmodernen wäre, da Vorherrschaft zwangsläufig auf Kosten anderer Nationen gehe. Die postmoderne Welt werde nur in Frieden leben, wenn sie sich in die Sphäre des Chaos einmische. Doch zu lange Interventionen stiessen in der Öffentlichkeit zunehmend auf Ablehnung, weshalb die postmoderne Welt die zusammengebrochenen Staaten kolonialisieren müsse. Allerdings sei Kolonialismus heute nicht mehr tragbar. Dennoch brauche es eine neue Form des Imperialismus, die an Menschenrechte und aufgeklärte Grundwerte glaube und diese exportiere. Zur freiwilligen Form des Imperialismus zählt Cooper die Wirtschaft, Weltbank, Währungsfonds. Daneben sieht er den „Imperialismus der Nachbarn“, welche Instabilität in einem Nachbarland oder einer benachbarten Region nicht ignorieren könnten.
Hier wäre anzumerken, dass der Term „Neuer Kolonialismus“ irreführend, ja ein eigentliches PR-Desaster ist, denn es geht nicht darum, fremdes Territorium dauerhaft zu besetzen, sondern darum, aus vormodernen postmoderne Staaten zu schaffen, die sich, einmal in die Freiheit entlassen, in die zivilisierte globale Gemeinschaft einfügen.
Neben Kritik erntete Cooper Zustimmung, so von Colin Powell, der in einem Interview mit dem New Yorker 2002 sagte: „Souveränität bringt auch Pflichten mit sich… eine ist es, seine eigenen Leute nicht zu massakrieren. Eine andere ist es, Terrorismus in keinerlei Weise zu unterstützen. Wenn eine Regierung es nicht schafft, diesen Verpflichtungen gerecht zu werden, dann verliert sie auch einige Vorzüge der Souveränität… Andere Regierungen… erlangen dagegen das Recht, zu intervenieren.“
Cook und Blair waren ebenfalls von Cooper beeinflusst. Laut Mischler glaubt Blair an das Gute im Menschen und dass auf die Niederschlagung des Bösen das Gute folge, weshalb er sich von Coopers „holzschnittartiger Darstellung“ angesprochen fühlte. Blair verwendete Coopers Ideen erstmals öffentlich auf dem Labour Parteitag im Oktober 2001 bezüglich dem bevorstehenden Krieg in Afghanistan, für Blair ein Paradebeispiel für einen gelebten Neuen Imperialismus, denn das Afghanistan der Taliban sei der Inbegriff eines gescheiterten Staates ((„failed state“). Doch laut Mischler entwickelte Blair Coopers Gedanken entscheidend weiter: Die Welt müsse nach 9/11 neu geordnet werden. Die postmodernen Staaten müssten sich der Hungernden, Elenden, Entrechteten und Ungebildeten von Nordafrika über die Slums von Gaza bis zu Afghanistan annehmen. Blairs Appell ging nicht nur an seine Landsleute, sondern an die ganze Welt, insbesondere an den Bündnispartner USA. Der Premier ergänzte Coopers „nachbarschaftlichen Imperialismus“ um Macmurrays Vorstellung von gegenseitigen Pflichten und Abhängigkeiten. Die alternative zur Globalisierung sei Isolation. Das Echo auf die Rede war gemischt, von „pathetisch“ über „Vorposten Amerikas“ bis zu Blairs „bester Stunde“ (im konservativen Daily Telegraph).
Der globale Terrorismus, den es zu besiegen gilt und für den es kein Verständnis geben kann, und das Recht der zivilisierten Welt, sich dagegen zu wehren, rückten während dem Afghanistanfeldzug in den Vordergrund von Blairs Denken. Er verteidigte Präventivschläge gegen die Bedrohung durch zurückgebliebene und gescheiterte Staaten. Der Kalte Krieg Ost gegen West sei vom Kampf der zivilisierten Staaten gegen den Terrorismus, der postmodernen gegen gescheiterte Staaten abgelöst worden. Gescheiterte Staaten exportieren Instabilität, Angst und Fanatismus.
In einer Rede vor dem US-Kongress erläuterte Blair im Juli 2003, dass in den gescheiterten Staaten ein fanatischer Zug religiösen Fanatismus entstanden sei, der den wahren und friedlichen Islam zu einem neuen und tödlichen Virus, dem Terrorismus, habe mutieren lassen. Bereits im Oktober 2001 erklärte Blair, dass Osama bin Laden und sein Marionettenregime in Kabul versuchen würden, die anderen muslimischen Regierungen umzustürzen und an ihre Stelle Regime der Angst, des Terrors und der Intoleranz setzen würden. Am 21. Dezember 2001 erklärte Blair, Afghanistan sei ein gescheiterter Staat gewesen, basierend auf Terrorismus und Drogen. Jetzt habe es die Chance auf Wiederaufbau.
Blairs grösste Angst ist, dass sich Terroristen Massenvernichtungswaffen beschaffen könnten. Tyrannen und Terroristen verfolgten das gleiche Ziel, weshalb der Premier 2002 und 2003 eine immer engere Verbindung zwischen Al-Qaida und den Massenvernichtungswaffen des Irak sah. Im März 2004 erklärte er in einer Rede in seinem Wahlkeis Sedgefield, dass in einer immer enger verzahnten Welt einzelne Mitglieder die Pflicht hätten, in einem anderen Land zu intervenieren, wenn dieses die Grundregeln der Gemeinschaft verletze. Er hielt ebenfalls fest, die Menschenrechtserklärung der Vereinten Nationen sei ein hübsches Dokument. Aber es sei seltsam, dass die UNO sie nur so widerwillig umsetze.
Am 12. September 2001 rief Bush erst gegen 12.30 in London an. Auf Blairs frage, ob er eine sofortige Reaktion in Erwägung ziehe, soll er geantwortet haben: „Natürlich denken wir darüber nach, aber ich habe nicht vor, Millionen von Dollars in den Sand zu schiessen, nur damit ich mich besser fühle.“ Er machte allerdings klar, dass die USA keinen Unterschied zwischen Terroristen und Staaten machen würden, die ihnen Unterschlupf gewährten.
Blair fürchtete, die USA könnten einseitig und ohne Absprache mit anderen Nationen reagieren, die USA könnten aus dem internationalen System aussteigen. Das soll der Premier bereits kurz nach den Anschlägen im kleinen Kreis gesagt haben. Bereits einen Tag nach den Anschlägen rief die NATO zum ersten Mal in ihrer Geschichte den Bündnisfall nach Artikel V aus.
Blair glaubte an seine Überredungskünste, andere Staatsmänner zur angelsächsischen Sicht der Lage bekehren zu können. In Grossbritannien führte Blair zwischen 9/11 und dem Afghanistan-Krieg den präsidialen amerikanischen Führungsstil ein, was ihm den Vorwurf einbrachte, mit den Traditionen der britischen Demokratie zu brechen. Zu seinem kleinen Kreis an Beratern gehörten Peter Mandelson, Nahostemissär Lord Levy und der aussenpolitische Chefberater David Manning.
In Afghanistan wollte Blair als Friedensstifter auftreten und die Friedenstruppen anführen. Doch Berlin warf London vor, britische Soldaten würden als Besatzer wahrgenommen, weshalb Deutschland die Truppen anführen solle. Der Streit endete mit einem Kompromiss, der vorsah, dass die Briten nach drei Monaten das Oberkommando an die Deutschen abgeben würden.
Blair war nach Kriegsende von den USA enttäuscht, die sich bei der Wiederaufbauarbeit zurückhielten. Für Blair hingegen war der Aufbau der Demokratie in Afghanistan von zentraler Bedeutung, seinem Konzept der Interdependenz der Staatenwelt folgend. Dazu musste er Bush gewinnen. Cheney und Rumsfeld verhehlten allerdings nicht, dass sie Blairs Vision einer neuen Weltordnung nicht teilten. Die neokonservativen Falken versuchten, den Einfluss des humanitären Londoner Visionärs so gering wie möglich zu halten. Für die USA waren stabile Verhältnisse in Afghanistan zweitrangig. Blair musste erkennen, dass die Amerikaner egoistischere Ziele verfolgten als er. Dadurch verlor der Brite vor der internationalen Gemeinschaft sein Gesicht, so Mischler, dessen Afghanistan-Bilanz ernüchternd ausfällt: Der neu gewählte Staatschef Karzai sei nicht mehr als ein Gouverneur Kabuls, ohne Polizei- und Militärkräfte, die seine Politik durchsetzen könnten. Erst zwei Jahre nach Kriegsende hätten die USA eingesehen, dass Rumsfeld Strategie, sich abstützen auf die Nordallianz um eigene Kräfte zu schonen, die Regierung in Kabul schwächte. Erst danach stellten die USA zusätzliche 1,7 Milliarden Dollar zum Wiederaufbau zur Verfügung und entsandten weitere Truppen. Doch die 20,000 westlichen Soldaten schafften es bis heute nicht, für Sicherheit zu sorgen. Der Opiumanbau in Afghanistan blüht erneut. Von hier stammt der Rohstoff für 95% des in Grossbritannien konsumierten Heroins. Blair muss sich eingestehen, so Mischler, dass weder eine stabile Demokratie aufgebaut noch die Brutstätten des Terrorismus vollständig vernichtet und die Drogenlieferungen an westliche Länder gestoppt werden konnten. Alles Ziele, die sich der Premier im Herbsts 2001 vorgenommen und medienwirksam verkündet hatte.
Am 29. Januar 2002 erklärte George W. Bush im US-Kongress in seiner Ansprache zur Lage der Nation Irak, Iran, Nordkorea und ihre terroristischen Alliierten bildeten eine Allianz des Bösen. Bereits wenige Stunden nach 9/11 fragte Rumsfeld: „Wieso sollten wir nur gegen Al-Qaida vorgehen, wieso nicht auch gegen den Irak?“ Rumsfeld, Wolfowitz und andere Neokonservative hatten bereits 1997 das Project for the New American Century (PNAC) gegründet, in dessen Statut sich die Initiative für eine globale Führungsrolle der USA findet. Am 26. Januar 1998 forderten sie von Präsident Clinton, Saddam Hussein zu entmachten und die Umgang der USA mit der UNO radikal zu überdenken. Die USA müssten ihre vitalen Interessen im Golf nötigenfalls auch mit militärischer Gewalt sichern und sich nicht durch das fehlgeleitete Beharren des UN-Sicherheitsrats auf Einstimmigkeit lähmen lassen. Unterschrieben von Rumsfeld, Wolfowitz, Cheney und Libby. Hier hätte Mischler anfügen können, dass es sich also mitnichten um eine geheime „neokonservative Verschwörung“ handelte, wie im amerikanischen Kontext „liberal“ genannte (in Europa „sozialistisch“ genannte) Kritiker bezüglich der neokonservativen Agenda öfters monierten.
Blair wusste um seinen begrenzten Einfluss in Washington. Er hoffte, Colin Powell und andere, die seine politischen Vorstellungen teilten, zu stärken. Mit Bush teilte der Premier allerdings die Einschätzung, dass Saddam Hussein als Bedrohung für den Westen beseitigt werden muss. Berichten seines Geheimdienstes MI6 entnahm Blair, dass der Irak seit dem Abzug der UN-Inspektoren 1998 seine Waffenprogramme wieder aufgenommen habe, was sich als falsch erwies. Mindestens drei Milliarden Dollar flossen jährlich aus nicht genehmigten Ölverkaufen des Irak in Saddams Tasche. Diese dienten möglicherweise der Entwicklung von Massenvernichtungswaffen. Wiederum eine falsche Annahme.
Noch am 26. Febuar 2003, vier Wochen vor Kriegsbeginn, hoffte Blair, die Entwaffnung des Iraks und die Beseitigung seiner Massenvernichtungswaffen zu erreichen. Laut Mischler gehörte der Sturz von Hussein nicht zum Ziel des Premiers, auch wenn er zugab, sich mit einem Irak ohne Diktator wohler zu fühlen. Bush hingegen sprach bereits seit April 2002 von einem Regimewechsel als Ziel. Für Blair war die Lösung des Palästinakonflikts vital für die Sicherheitsinteressen des Westens, für Bush war damals eine Nahost-Friedensinitiative zweitrangig. Die USA handelten egoistisch wie eine moderne macht im Sinne von Cooper, so Mischler.
Blairs Dilemma war zudem, dass er die Unterstützung des Unterhauses und seiner Landsleute für einen Irakkrieg nur gewinnen konnte, wenn dieser auf der Grundlage einer UN-Resolution geführt wurde. Nach 9/11 riess der Nationale Sicherheitsrat das Ruder in der amerikanischen Aussenpolitik gewaltsam herum. Sicherheitsberaterin Rice forderte, sich aus dem Palästina-Konflikt rauszuhalten und sich stattdessen auf Saddam Hussein zu konzentrieren. 2005 hatte sich dies allerdings geändert, wie Bush und Rice mehrfach klarmachten, was der Autor hier (noch) nicht erwähnt.
Bush ging mit seinem Verbündeten in London höchst unsensibel um – überhaupt ein Markenzeichen der Ära Bush junior. Clinton hatte im Dezember 2000 Blair geraten, Bushs bester Freund zu sein. Doch all das zahlte sich nicht aus. Die zwei wurden keine wirklichen Freunde, die Beziehung sind nicht wirklich „speziell“. Bush bezeichnet Mischler als „erzkonservativ und bigott“, Blair hingegen als „intellektuell“, „in der linken Mitte“ stehend, „von sozialen Werten überzeugt“, mit einem „tiefen Glauben“. Die zwei hätten folglich nichts gemein, im Gegensatz zum Paar Blair-Clinton, das zudem eine echte, tiefe Freundschaft verbinde.
Blair kam trotzdem zum Schluss, dass er Bush unterstützen werde, da er davon überzeugt, dass die westliche Welt Saddam Hussein entwaffnen muss. Doch der Premier konnte dem US-Präsidenten keine weitere UN-Resolution als Kriegsgrundlage abringen. Die Berater im britischen Aussenministerium erklärten, eine Invasion ohne Zustimmung der UNO verstosse gegen das Völkerrecht. Cheney versuchte, Blairs Einfluss auf Bush zu minimieren. Er sah in ihm einen Alliierten seines „Erzfeindes“ (Mischler) Powell. Bush und Blair kamen überein, dass erneut ein Waffeninspektorenteam in den Irak gesandt werden solle, was eine Woche nach dem Treffen im Weltsicherheitsrat auf einhellige Zustimmung stiess. Als Bush vor die UN-Vollversammlung trat, fehlte im Text auf dem Teleprompter die Passage über eine weitere UN-Resolution. Bush improvisierte und äusserte danach gegenüber dem britischen Aussenminister Straw den Verdacht, dass Cheney den Teleprompter manipuliert haben könnte.
Am 24. September gab Downing Street gestützt auf Geheimdiensterkenntnisse einen Bericht heraus, nach dem der Irak biologische Waffen besitze und nicht nur Kurzstreckenraketen mit 150km Reichweite, sondern auch ballistische Raketen produziere, die deutlich weiter fliegen könnten. Zudem unterhalte der Irak ein Atomprogramm und habe Aluminiumröhren für den Bau einer Urananreicherungsanlage importiert sowie sich erfolglos im Niger um den Kauf von waffenfähigem Plutonium bemüht. Blair glaubte, das Dossier werde die Skeptiker in Britannien überzeugen.
Auf dem Labour-Parteitag in Blackpool verteidigte der Premier eindrücklich seine Politik. Es gehe im Irak nicht nur um die Entwaffnung Saddams, sondern um einen umfassenden Friedensprozess. Bis Jahresende werde er die Verhandlungen zwischen Israelis und Palästinensern wiederbeleben, die zu einem von der arabischen Welt anerkannten israelischen und einem lebensfähigen palästinensischen Staat führen sollten. So gewann Blair eine Mehrheit von 60% der Delegierten seiner Partei, welche Militärschläge gegen den Irak unter einem UNO-Mandat befürworteten.
Zwei Tage später einigten sich die UNO und der Irak in Wien auf neue Waffeninspektionen unter der Führung von Hans Blix. Die USA kündigten den Entwurf einer neuen UN-Resolution an, welche die Arbeit der Inspekteure schützen und unterstützen sollte. Am 8. November 2002 wurde die Resolution 1441 verabschiedet. Blair setzte eine Kompromissformel durch, welche die Tür für eine zweite Resolution offenhielt, die einen Krieg ausdrücklich absegnen könnte. Damit machte er sich keine Freunde in Europa. Laut Mischler war Chirac der Ansicht, Blair habe ihm die traditionelle Führungsrolle Frankreichs in Europa abgenommen. Gerüchten zufolge soll Chirac im November 2002 beschlossen haben, Blair die Flügel zu stutzen. Sollte eine zweite Resolution nötig werden, könne Blair nicht mehr auf Frankreichs Unterstützung zählen.
Am 8. Dezember 2002 legte der Irak, wie von Resolution 1441 verlangt, einen neuen Bericht über seine Waffenarsenale und -programme vor. Auf den 12,000 Seiten stand jedoch nichts Neues, woraus Bush und Blair schlossen, Saddam Hussein habe seine letzte Chance ausgeschlagen. Elf Tage nach Vorlage des Berichts stellte Bush fest, das Dokument reiche nicht aus und der Irak verstosse ernsthaft gegen die Resolution. Grossbritannien beschleunigte nun seine Kriegsvorbereitungen.
Ende Januar 2003 reiste Blair zu Bush, um Unterstützung für eine zweite UN-Resolution, mehr Zeit für die Waffeninspektoren und einen umfassenden Nahostfriedensplan zu bitten. Offiziell gab Bush in keinem der drei Punkte eine Zusage. UNO-Verhandlungen bezeichnete er als Zeitverschwendung. Die abschliessende Pressekonferenz wurde zuerst verschoben, dann auf brüskierende Weise für Blair nach einer Viertelstunde vorzeitig abgebrochen. Gleichzeitig begann Washington, die Arbeit der UN-Inspektoren im Irak zu boykottieren und lächerlich zu machen. Der zweite Bericht von Blix vom 14. Februar 2003 sparte alles aus, was Briten und Amerikaner als Beweis für einen Resolutionsverstoss hätten werten können. Blix und sein Kollege von der Internationalen Atomenergiebehörde, El Baradei, berichten vielmehr von den grossen Fortschritten, den der Irak bei der Zusammenarbeit mache. Powell machte jedoch wütend klar, dass mehr Inspektoren keine Lösung seien. Blair hingegen nahm der Bericht jeden Kriegsgrund. Für ihn war es ein innenpolitisches Desaster.
Der Premierminister geriet unter immer stärkeren innenpolitischen Druck, hielt aber an der Richtigkeit seines Kurses fest. Anfang Februar 2003 musste er allerdings zugeben, dass das Irakdossier vom 30. Januar ein Plagiat war und weite Teile davon der zehnjährigen Doktorarbeit des Amerikaners Ibrahim al-Marashi entstammten. Am 15. Februar kam es zur grössten Demonstration in London, die es in Grossbritannien je gegeben hat: Zwischen mindestens 750,000 (nach Polizeiangaben) und 1,5 Millionen (nach Veranstalterangaben) Menschen nahmen daran teil. Auf die Warnung des US-Botschafters in London, Blair brauche Unterstützung, reagierte Washington nicht. Im Gegenteil, Bush tat eine zweite UN-Kriegsresolution als irrelevant ab, womit er Blairs Glaubwürdigkeit weiter untergrub, der nach einer UN-Mehrheit dafür suchte. Blair soll so verzweifelt gewesen sein, dass er laut seiner Ex-Entwicklungsministerin Claire Short (eine Version gestützt von Richard Butler) die UN-Büros von Kofi Annan, Hans Blix und Mitgliedern des UN-Sicherheitsrats abhören liess.
Frankreich erklärte, sein Veto gegen eine neue UNO-Resolution einzubringen. Das lieferte Blair die Entschuldigung, ohne UNO-Zustimmung in den Krieg zu ziehen. London konnte Paris das Scheitern einer Verhandlungslösung in die Schuhe schieben. Die Zahl der Labour-Abweichler sank wieder. Laut Woodward (Plan of Attack) bot Bush Blair dreimal an, sich aus dem Irakkrieg rauszuhalten, doch Blair blieb an der Seite Washingtons. Der Premierminister war sogar zum Rücktritt bereit, hätte er im März 2003 eine Abstimmungsniederlage bezüglich des Irakkriegs erlitten.
Als Chile dem Irak 30 Tage Zeit geben wollte, um der internationalen Forderung der Entwaffnung nachzukommen, fegte der Sprecher des Weissen Hauses, Ari Fleischer, den Vorschlag binnen 20 Minuten vom Tisch. Blair war schockiert, wie herablassend Bush die UN behandelte. Doch dann konnte Blair doch noch einen Erfolg vorweisen, denn Bush lenkte in eine Nahost-Initiative ein, die der Präsident und der Premier am 14. März 2003 fast gleichzeitig ankündigten.
Mischler bezeichnet den Irakfeldzug als „gescheiterten Krieg“. Am 1. Mai 2003 verkündete Bush zwar die Kampfhandlungen im Irak für beendet, doch jetzt fingen die Probleme erst richtig an. So kam es zu Plünderungen in Krankenhäusern, Botschaften, Geschäften und selbst im Nationalmuseum und der Nationalbibliothek. Nicht die Amerikaner, sondern Chaos und Gewalt herrschten in Bagdads Strassen, vermerkt Mischler zurecht. Doch er vergisst zu erwähnen, dass Besatzungsmächte laut Völkerrecht dazu verpflichtet sind, für Ruhe und Ordnung in dem von ihnen besetzten Gebiet zu sorgen, was die USA bewusst unterliessen und dies sogar noch öffentlich bekundeten. Und Blair stand Gewehr bei Fuss. Hier ist eine der wenigen rechtlich eindeutigen Situationen, die es erlauben, die USA (und damit auch Blair) anzugreifen. Doch Mischler verpasst die Gelegenheit auf die Haager Landkriegsordnung von 1907 zu verweisen. Diese stipuliert in ihrem Art. 43 ((Wiederherstellung der öffentlichen Ordnung): „Nachdem die gesetzmäßige Gewalt tatsächlich in die Hände des Besetzenden übergegangen ist, hat dieser alle von ihm abhängenden Vorkehrungen zu treffen, um nach Möglichkeit die öffentliche Ordnung und das öffentliche Leben wiederherzustellen und aufrechtzuerhalten, und zwar, soweit kein zwingendes Hindernis besteht, unter Beachtung der Landesgesetze.“ Detaillierte Regelungen für Fälle wie die Irakbesetzung liefert das Genfer Abkommen zum Schutze von Zivilpersonen in Kriegszeiten von 1949. Es versteht sich von selbst, dass Grossbritannien Vertragsstaat beider Abkommen ist.
Die Unzufriedenheit im Irak wuchs im Sommer 2003. Islamistische Terroristen traten nun auf den Plan. Im Gegensatz zu den Amerikanern sandten die Briten wenigstens keine Soldaten in den Irak, die nicht zumindest „Guten Tag“, „Entschuldigung“ und „Danke“ auf arabisch sagen konnten. Zudem verzichteten die britischen Soldaten auf Provokationen. So setzten sie keine Spürhunde in Häusern ein, denn Hunde im Hause eines Moslems wären für diesen eine grobe Beleidigung. „Die Geste kommt an“, so Mischler.
Allerdings reagierte Blair laut Mischler ungeschickt auf die Foltervorwürfe und darauf, trotz frühzeitigen Mahnungen nichts unternommen zu haben. Der Premier meinte nur, er hätte den Bericht nie gesehen und wie seine Minister erst aus der Zeitung davon erfahren. Ein Mitarbeiter sagte die peinlichen Worte: „Unser Premierminister kümmert sich nicht um jedes einzelne Gefängnis in diesem Land… Diese Dinge werden auf der Verwaltungsebene geregelt.“ Blair sagte am 13. Mai, die im Mirror veröffentlichten Folterfotos seien mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit gefälscht. Mischler vergisst zu erwähnen, dass diese Fotos tatsächlich gefälscht waren. Auch wenn später einige andere Folterungen zum Vorschein kamen, so sind unter den Briten keine grossflächigen Skandale wie Abu Ghraib und Guantanamo geschehen.
Peinlicher für Blair persönlich war der Fakt, dass keine Massenvernichtungswaffen gefunden wurden. Für Bush war dies weniger schlimm, denn die WMDs waren in den USA als Kriegsbegründung zweitrangig. Dort wurde der Irakkrieg vor allem als zweite Reaktion nach Afghanistan auf die Anschläge vom 11. September 2001 wahrgenommen. Wolfowitz verstieg sich gar zum Kommentar, die Massenvernichtungswaffen seien nur aus „bürokratischen Gründen“ als Kriegsmotiv vorgeschoben worden. Das US-Verteidigungsministerium versuchte danach die Äusserung des stellvertretenden Ressortchefs herunterzuspielen, doch er sagte nur, „was Kriegsgegner in aller Welt befürchtet haben: London und Washington haben die angebliche Bedrohung durch den Irak aufgebauscht“, so Mischler. Der Butler-Bericht kam später zum Schluss, Blair habe nicht gelogen, sei aber nicht sorgsam genug mit sensiblen Informationen umgegangen, wie der Autor korrekt anmerkt.
Blairs Büro war mit den Geheimdienstbeiträgen zum Irakdossier nicht zufrieden, weil die Spione der Ansicht waren, das von möglichen Massenvernichtungswaffen des Irak im Sommer 2002 keine grössere Gefahr ausgehe, als direkt nach dem ersten Golfkrieg. Deshalb liess Downing Street das Dossier mehrmals umschreiben. Die Behauptung, der Irak könne innert 45 Minuten mit biologischen und chemischen Kampfstoffen bestückte Sprengköpfe abschussbereit machen, wurde immer schärfer formuliert. Blairs Kommunikationschef Campbell liess Konjunktive zu Indikativen umformulieren, Möglichkeiten zu Tatsachen aufbauschen, bemerkt Mischler zurecht. So heisst es nicht mehr, der Irak sei „vielleicht“ in der Lage, Massenvernichtungswaffen einzusetzen, sondern nur noch, er sei dazu in der Lage. Kurz vor der Drucklegung wird noch der Titel des Dossiers von „Iraks Programme für Massenvernichtungswaffen“ zu „Iraks Massenvernichtungswaffen“ geändert. Sex it up, nennen das die Engländer.
Als grössten Skandal von Blairs Regierungszeit bezeichnet Mischler jedoch den Freitod des Biowaffenexperten David Kelly im Sommer 2003. Kelly war gegen die Aufnahme der 45-Minuten-Behauptung gewesen. Seine Meinung wurde jedoch übergangen. In der morgendlichen Nachrichtensendung des Channel 4 der BBC vom 29. Mai 2003 berichtete der Reporter Andrew Gilligan, Downing Street und die Kommunikationsabteilung hätten das Irakdossier absichtlich „nachgebessert“, Passagen eingefügt, von denen klar war, dass sie unzuverlässig, wenn nicht gar falsch waren. Insbesondere die 45-Minuten-Behauptung sei nachträglich und wider besseres Wissen und den Willen der Geheimdienste eingefügt worden. Claire Short sprach damals öffentlich von Halbwahrheiten und Übertreibungen, Robin Cook legte im Mai 2003 sein Amt nieder. Hans Blix erklärte, er habe nichts gefunden, was die 45-Minuten-Behauptung stütze.
Campbell startete „einen sinnlosen und unnötigen Rachefeldzug gegen die BBC“, so Mischler. Campbell wollte den Sender diskreditieren, die BBC erniedrigen. Der öffentlich-rechtliche Sender habe während des Irakkriegs die Finger in offene Wunden der Regierung gelegt. Campbell bombardierte in jener Zeit die BBC mit Beschwerdebriefen. Kelly geriet ins Kreuzfeuer. Er hatte als geheime Quelle für Gilligan gegen die Regel des Verteidigungsministeriums verstossen, dass Mitarbeiter vor Mediengesprächen grundsätzlich das Okay ihres Vorgesetzten einholen müssen. Der Verdacht fiel rasch auf Kelly als Quelle Gilligans. Dieser gestand am 30. Juni brieflich seinem Vorgesetzten den Sachverhalt. Die Regierung erfuhr davon und wollte nun Kelly instrumentalisieren, denn er ist nicht wie im Bericht behauptet ein Mitarbeiter des Geheimdienstes, sondern arbeitete als Experte nur am Bericht mit. Campbell und Verteidigungsminister Hoon forderten von Blair, Kelly zu „outen“. Der Premier stimmte zu. Kelly wurde zu ständig neuen Aussprachen und Anhörungen vorgeladen. Zudem wurde ihm eine Irakreise gestrichen. Ihm wird mit einem Disziplinarverfahren und dem Entzug der Pension gedroht. Sein Name wurde der Presse preisgegeben. Kelly hielt dem Druck nicht stand und beging Selbstmord.
Im August 2003 nahm eine Untersuchungskommission ihre Arbeit zu Kellys Freitod auf. Auf Plakaten wurde Blair inzwischen als B-liar (Lügner) verhöhnt. Der Hutton-Report kam jedoch zum Schluss, dass das Irakdossier der Regierung keine Informationen enthielt, denen die Geheimdienste nicht zugestimmt hätten. Die Regierung habe bei der 45-Minunten-Behauptung nicht wider besseres Wissen gehandelt. Mischler bemerkt dazu: „Für die BBC war der Hutton-Bericht trotz seiner offensichtlichen Einseitigkeit eine Niederlage.“ Am Tag nach der Veröffentlichung traten der Vorsitzende der BBC und der Nachrichtenchef zurück. Der Sender geriet in Gefahr, seine Unabhängigkeit zu verlieren. Blair liess danach noch den oben erwähnten Butler-Bericht zum Irakdossier anfertigen, der ihm im Juli 2004 nur fehlende Sorgfalt vorwarf. Mischler verweist abschliessend darauf, dass sogar die CIA die Quelle für die 45-Minuten-Behauptung für so zweifelhaft hielt, dass der US-Geheimdienst sie als Schwindel einstufte. Blair hingegen ignorierte derartige Einwände.
Um seine Glaubwürdigkeit wiederzuerlangen, appellierte Blair nach dem Irakkrieg an Bush, den Frieden zu gewinnen, insbesondere vor Bushs Wiederwahl im November 2004. Blair trieb die Pläne für eine Friedenskonferenz voran. Zuerst gegen den Wunsch von Bush, der zunächst gegen die Mullahs vorgehen wollte. Blair stand an der Seite Bushs, wollte sich aber gleichzeitig wieder Europa annähern. Er wollte die USA und Europa als Partner, zwischen denen das Vereinigte Königreich vermittelt. Wenn Europa und die USA zusammenarbeiteten, so würden auch die anderen Staaten kooperieren, so Blairs Credo. Nichts sei gefährlicher als die Idee, die Macht der USA mit rivalisierenden Mächten ausgleichen zu wollen.
Im November 2001 erklärte der Premier, amerikanische Politiker von Dean Acheson bis George Bush hätten sich ein starkes geeintes Europa gewünscht, deshalb müsse Europa seine Aussen- und Sicherheitspolitik koordinieren und effizienter gestalten. Bereits 1998 setzte sich Blair für die Harmonisierung der EU-Verteidigungspolitik ein. In der Folge trat er für eine Europa-Armee ein. Frankreich wollte das auch, aber um zu zeigen, dass Europa ohne die USA bestehen könne. London und Paris gerieten aneinander. Chirac wollte eine vom europäischen NATO-Hauptquartier unabhängige Eingreiftruppe. Blair war entrüstet. Im Dezember 2002 verwarf er gar die Idee einer EU-Eingreiftruppe, weil er nach 9/11 mit den USA enger zusammen arbeiten wollte. Mitten im Irakkrieg, im April 2003, schlugen Frankreich, Deutschland, Belgien und Luxemburg eine europäische, von der NATO unabhängige Kommandozentrale vor. Das Pentagon war beunruhigt. Blair war zuerst dagegen, machte dann jedoch im September 2003 doch mit, um einen Monat später einen Rückzieher zu machen, da der NATO keine Konkurrenz entstehen dürfe. Im Frühjahr 2004 änderte Blair erneut seine Meinung. Zusammen mit Frankreich und Deutschland will er eine Eingreiftruppe aufstellen, die bis 2007 weltweit für friedenserhaltende Einsätze mobilisiert werden kann. Doch Blair ist isoliert, Paris und Berlin haben die Führungsrolle übernommen.
Europapolitisch war und ist Blair im Zwiespalt: Den britischen Wählern will er klar machen, dass die EU-Mitgliedschaft im Interesse Britanniens ist. Nur so kann Einfluss auf Veränderungen innerhalb der EU genommen werden. Zudem wickle das Vereinigte Königreich rund 60% seines Aussenhandels mit EU-Staaten ab. Ein EU-Ausstieg wäre ein Desaster für Britanniens Handel, Jobs und Einfluss in der Welt. Gleichzeitig jedoch setzt er sich gegen die Brüsseler Bürokratie, die Entwicklung der EU zu einem Superstaat ein, der ineffizient und ohne Legitimation wäre. Im Sommer 2003 entschied sich zudem Gordon Brown gegen die Einführung des Euro auf der Insel, da Grossbritannien laut dem Schatzkanzler für die neue Währung noch nicht bereit sei.
Mischlers Blair-Biografie wurde vor dem Labour Wahlsieg 2005 und dem Scheitern der EU-Verfassung u. a. in Frankreich fertiggestellt. Zur Zukunft des Premiers meint Mischler, Blair müsse versuchen, das Land nach der Zerreissprobe des Irakkriegs zu versöhnen. Fortschritte im Friedensprozess in Palästina brächten ihn diesem Ziel ein Stück näher. Die Aussenpolitik müsse in seiner dritten Amtszeit jedoch zurücktreten, da die Modernisierung der öffentlichen Dienste und der veralteten Infrastruktur Priorität hätten. Die Wahlversprechen von 1997 habe der Premier noch nicht erfüllt. Dazu gehören die Behebung der endlosen Wartezeiten in Krankenhäusern, der verheerenden Zustände an den Schulen in ärmeren Wohngegenden, des miserablen Zustands der britischen Eisenbahnen und der Londoner U-Bahn. Nur wenn es ihm gelinge, den öffentlichen Bereich für die Briten spürbar zu verbessern, würden ihm seine Landsleute den Irakkrieg verzeihen und New Labour als die richtige Wahl betrachten.
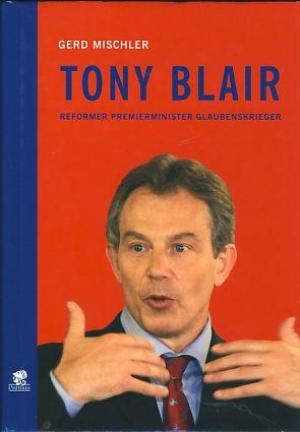
Gerd Mischler: Tony Blair. Reformer Premierminister Glaubenskrieger. Parthas Verlag, 2005, 350 S. Biographie bestellen bei Amazon.de.
[Hinzugefügt am 10.5.2007: Heute, nach zehn Jahren an der Macht, hat Tony Blair angekündigt, dass er am 27. Juni 2007 vom Amt des Premierministers in Grossbritannien zurücktreten werde].
Artikel vom 20. September 2005